DAS
HERZ UNTER DORNEN VERBORGEN
Ein Nachruf auf André de Toth von Thomas
Klarmeyer
André de Toth wurde 1912 oder 1913 im ungarischen Mako geboren; gestorben ist er zum ersten Mal in den 30er Jahren in Wien, als er in Straßenunruhen geriet, das Bewußtsein verlor und im Leichenschauhaus wieder aufwachte. Dann wurde er aber doch nur als halb tot eingestuft, vom Namenszettel an seinem Zeh befreit und aus der Leichenhalle entlassen („Wir haben Glück. Ein toter Ausländer kann eine Menge Ärger machen“). Erfreulicherweise, denn so konnte de Toth noch eine ganze Reihe wunderbarer Filme drehen – darunter zwei meiner Lieblingswestern, mindestens einen der allerschönsten Film Noirs und den vielleicht zynischsten Kriegsfilm aller Zeiten – und nicht zuletzt die glänzend geschriebene Autobiographie „Fragments“ verfassen, in der man neben der Wien-Geschichte noch eine Menge ziemlich atemberaubender Storys aus seinem Leben nachlesen kann.
I
De Toth hat unter anderem als Kameraassistent, Schauspieler und Autor gearbeitet, ehe er 1939 in Ungarn in rascher Folge seine ersten fünf Filme als Regisseur drehte. Jean-Pierre Coursodon und Bertrand Tavernier, die diese Filme bei einer Retrospektive in Lyon sehen konnten, schwärmen in ihrem Buch über das amerikanische Kino vor allem von KÉT LANY AS UTCAN (was man mit „Zwei Mädchen auf der Straße“ übersetzen kann): „Der Film verblüfft mit seiner Geschwindigkeit, seiner elliptischen Kürze, seinem visuellen Einfallsreichtum. De Toth trotzt hier einer Reihe von sexuellen und sozialen Tabus, entwickelt seine zehn Figuren mit Wärme und an Renoir erinnernder Leichtigkeit, zeigt zahlreiche Außenschauplätze, rhythmisiert durch eine exzellente Musik in der Manier Paul Dessaus, und führt seine beiden Hauptdarstellerinnen in einem sehr modern anmutenden Stil.“
1940 emigrierte de Toth, zunächst nach Großbritannien, wo er für zwei andere gebürtige Ungarn arbeitete, den berühmten Produzenten Alexander Korda und dessen Bruder Zoltan, damals einer der renommiertesten englischen Regisseure – unter anderem war de Toth Produktionsassistent bei THE THIEF OF BAGDAD (die klassische Verfilmung mit Sabu und Conrad Veidt) und THE FOUR FEATHERS und Second-Unit-Director für THE JUNGLE BOOK. Zwischen 1943 und 1960 arbeitete er dann in Hollywood, wo er knapp zwei Dutzend Filme inszenierte. Zu seinen renommiertesten Werken gehören der Anti-Nazi-Film NONE SHALL ESCAPE und der Drogenfilm MONKEY ON MY BACK (DER TEUFEL IM NACKEN) mit Cameron Mitchell als morphiumsüchtigem Ex-Boxchampion, der besser ist als Otto Premingers zwei Jahre früher entstandener und überschätzter MAN WITH THE GOLDEN ARM. 1953 drehte de Toth den vielleicht schönsten 3-D-Film, den Horrorfilmklassiker HOUSE OF WAX (DAS KABINETT DES PROFESSOR BONDI), und gerne wird auf die Pointe hingewiesen, daß ausgerechnet ein einäugiger Filmregisseur diesen legendären 3-D-Film inszeniert habe; aber man muß bedenken, daß de Toth auch als Bildhauer arbeitete und sehr geschätzte Bronzestatuetten schuf und daher einen ausgesprochen engen Bezug zur Dreidimensionalität hatte. Viel später hat de Toth von neuen technischen Möglichkeiten geträumt, von der ultimativen Fusion von Theater und Film, ein 360°-Kino, das wie eine Plastik sein solle.
Aber sein Allerbestes hat de Toth vielleicht doch im Western und im Film Noir gegeben. Was man über Noirs wie PITFALL oder den grandios besetzten SLATTERY’S HURRICANE (STURMFLUG) – unter anderem mit Richard Widmark, John Russell, Linda Darnell und Veronica Lake – liest, klingt großartig; aber leider habe ich sie noch nie sehen können. Mit Sicherheit eines der großen Meisterwerke des Genres ist aber CRIME WAVE von 1954.
II
In CRIME WAVE (VON DER POLIZEI
GEHETZT) geht es um drei entflohene Sträflinge; auf ihrer Flucht überfallen sie
eine Tankstelle, werden aber von einem Polizisten überrascht; es kommt zu einem
Schußwechsel, bei dem der Polizist getötet und einer der Gangster schwer
verletzt wird. Der Verwundete flüchtet – nachdem er sich von seinen Kumpanen
getrennt hat – zu einem alten Komplizen (Gene Nelson), der inzwischen auf
Bewährung entlassen ist; Nelson hat sich vom Verbrechen losgesagt, einen guten
Job in einer Flugzeugfabrik bekommen, eine tolle Frau geheiratet (Phyllis Kirk)
und sieht sich nun plötzlich wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Der
verletzte Gangster stirbt in Nelsons Wohnung, noch bevor der von  ihm
hinbestellte Arzt eintrifft, und im Folgenden geraten Nelson und Kirk dann
mitten zwischen die Fronten: der ermittelnde Polizist (Sterling Hayden), ein
knallharter Zyniker und moralischer Absolutist, für den es keine Grautöne in
den Menschen zu geben scheint, glaubt nicht an Nelsons Läuterung, während
gleichzeitig die beiden anderen Sträflinge auftauchen und sich bei Nelson und
Kirk einnisten, um dort ihren nächsten Coup, einen Banküberfall, zu planen.
ihm
hinbestellte Arzt eintrifft, und im Folgenden geraten Nelson und Kirk dann
mitten zwischen die Fronten: der ermittelnde Polizist (Sterling Hayden), ein
knallharter Zyniker und moralischer Absolutist, für den es keine Grautöne in
den Menschen zu geben scheint, glaubt nicht an Nelsons Läuterung, während
gleichzeitig die beiden anderen Sträflinge auftauchen und sich bei Nelson und
Kirk einnisten, um dort ihren nächsten Coup, einen Banküberfall, zu planen.
Von der ersten Minute – dem Überfall auf die Tankstelle – an fasziniert einen CRIME WAVE durch seine visuelle Schönheit (Kamera: Bert Glennon), eine sehr amerikanische Form von gewissermaßen „beiläufiger“ Schönheit, die einen vielleicht an Fotografien von Robert Frank oder William Eggleston denken läßt: Bilder, die nur mit den alltäglichsten Zeichen arbeiten (etwa in ihrem Umgang mit Schildern, Reklamen, Leuchtzeichen) und diese in eine ebenso unaufdringliche wie perfekt ausgewogene Komposition einpassen. De Toths Inszenierung ist auf ähnlich unangestrengte Weise vollkommen; jede Szene des Films ist bis ins letzte Detail durchgestaltet, ohne jemals mit ihrer Brillanz zu protzen; selbst das offensichtlichste Gestaltungsmittel – die häufigen Kameraschwenks, oft über mehr als 180 Grad – wirkt eher als ökonomisch funktionale Auslotung des Raumes denn als Demonstration inszenatorischer Virtuosität. Man muß sich nur einmal ansehen, wie de Toth das Polizeirevier inszeniert, als einen Ort der Verlorenheit mit seinen kahlen Fluren und hohen Decken, die Menschen und Mobiliar zu Randfiguren reduzieren, und wird daraus vielleicht mehr über die Kunst des Kinos lernen als aus manchem viel berühmteren Filmklassiker. – Und natürlich lebt CRIME WAVE auch von seiner wunderbaren Besetzung, die bis in die kleinste Rolle einfach perfekt ist. Sterling Hayden spielt eine seiner größten Rollen als desillusionierter und über die Maßen hart gewordener Cop, dem am Ende eine wunderbare Erlösung zuteil wird (eine Szene, die in der noch zu schreibenden Geschichte der Zigarette im Film nicht fehlen darf: Jean-Pierre Melville, der sich mehrmals bei Motiven von CRIME WAVE bediente, hat sie 1966 für LE DEUXIÈME SOUFFLE geklaut) – „the detective who had his heart hidden behind thorns“, wie de Toth ihn beschreibt, war die Lieblingsrolle des Schauspielers. Gene Nelson, der eigentlich vom Musical und vom Tanz herkam und später selber Regisseur wurde (unter anderem hat er zwei Elvis-Filme inszeniert), und Phyllis Kirk, eine Lieblingsschauspielerin de Toths, sind glänzend als das Liebespaar des Films, in einer fast ausweglosen Situation gefangen. Und fast jede Nebenrolle verdichtet de Toth zu einer kleinen Charakterstudie, vom Arzt, der nach einem häßlichen Zwischenfall in seiner Vergangenheit keine Menschen mehr behandeln will, sondern nur noch Tiere (eine grandiose Studie der Verzweiflung), über einen unberechenbar-irren und geilen Verbrecher (von Timothy Carey gespielt, einem der tollen wilden Männer Hollywoods, dem man wirklich jede Form des Wahnsinns zutrauen würde), bis zu Gene Nelsons Chef in der Flugzeugfabrik, eine winzige Rolle, der der wunderbare Hank Worden – der in vielen großen Western gespielt hat; sein berühmtester Auftritt war der Mose Harper in John Fords THE SEARCHERS – Prägnanz und Format verleiht.
III
André de Toth war vielleicht der einzige Immigrant, der ein wirklich großer Westernregisseur wurde; ein Genre, das sonst fast ganz und gar den gebürtigen Amerikanern gehört, den Ford und Hawks, Boetticher und Anthony Mann, Vidor und Walsh. RAMROD (DIE FARM DER GEHETZTEN) von 1948 war sein erster Ausflug an die mythische frontier, und in den frühen 50ern hat er dann eine ganze Reihe von kleinen B-Western gedreht, die die besten Qualitäten dieses Genres besitzen, in dem es um die kunstlos wirkende Kunst der Vereinigung von Gegensätzen geht: Lässigkeit und Anspannung, lakonische Funktionalität der Erzählung und die Konventionen des Genres variierende Invention, kompromißlose Aktion und Kontemplation, verbunden durch den Sinn für die rauhe Landschaft und die Menschen, die diese Landschaft bevölkern, und das Licht, das über den Schauplätzen der Geschichte liegt.
LAST OF THE COMANCHES (DER LANGE
MARSCH DURCH DIE WÜSTE) zum Beispiel, von 1953, eine kleine Elegie auf die
Toten der Kavallerie, deren Geist John Ford gefallen haben muß (Ford schätzte
de Toth tatsächlich sehr): keine große  Geschichte,
sicher, aber es gibt Momente, an die man sich erinnern wird: den Schauplatz,
die Ruine einer spanischen Mission mitten in der Wüste, einige wunderbare
Einstellungen im Zwielicht der Dämmerung, Sonnenauf- und -untergänge, ein paar
verstreute Menschen im Gegenlicht. Ein Soldat, der einem Kameraden eine lange
Geschichte von seiner großen Liebe erzählt, um diesem die Angst vor dem Tod zu
nehmen, und plötzlich von einem Pfeil getroffen wird und stirbt; ein brennendes
Holzkreuz auf einem Hügel, das schließlich in sich zusammenstürzt. Und die
namenlosen Gräber in der Wüste, die wir am Ende noch einmal sehen, wenn
Broderick Crawford seine Totenrede auf die lakonischen Helden des Films
spricht. Oder, im Bürgerkriegswestern SPRINGFIELD RIFLE (GEGENSPIONAGE) von
1952, die Einsamkeit von Gary Cooper, der sich unehrenhaft aus der
Nordstaatenarmee ausstoßen läßt, um einen Spionagering der Gegenseite
aufzudecken; vor versammelter Mannschaft reißt man ihm die Jacke vom Leib und
malt ihm dann einen breiten gelben Streifen als Zeichen der Schande auf sein
Hemd; später wird seine Familie beinahe zerbrechen, und als die wenigen Männer
getötet werden, die seinen Geheimauftrag kannten, muß er Momente einer geradezu
quälenden Verlassenheit erleben. SPRINGFIELD RIFLE ist übrigens auch ein
visuell sehr schöner Film, mit wunderbaren Schneeszenen (die de Toth unter
Protest seines Kameramanns drehte); und ein sehr intelligenter Film, in dem es
um das Verhältnis von ehrbarem Handeln und dem Urteil der Menschen geht, oder,
einmal kantianisch formuliert, um die Bedingungen der Möglichkeit von
Rechtschaffenheit an sich.
Geschichte,
sicher, aber es gibt Momente, an die man sich erinnern wird: den Schauplatz,
die Ruine einer spanischen Mission mitten in der Wüste, einige wunderbare
Einstellungen im Zwielicht der Dämmerung, Sonnenauf- und -untergänge, ein paar
verstreute Menschen im Gegenlicht. Ein Soldat, der einem Kameraden eine lange
Geschichte von seiner großen Liebe erzählt, um diesem die Angst vor dem Tod zu
nehmen, und plötzlich von einem Pfeil getroffen wird und stirbt; ein brennendes
Holzkreuz auf einem Hügel, das schließlich in sich zusammenstürzt. Und die
namenlosen Gräber in der Wüste, die wir am Ende noch einmal sehen, wenn
Broderick Crawford seine Totenrede auf die lakonischen Helden des Films
spricht. Oder, im Bürgerkriegswestern SPRINGFIELD RIFLE (GEGENSPIONAGE) von
1952, die Einsamkeit von Gary Cooper, der sich unehrenhaft aus der
Nordstaatenarmee ausstoßen läßt, um einen Spionagering der Gegenseite
aufzudecken; vor versammelter Mannschaft reißt man ihm die Jacke vom Leib und
malt ihm dann einen breiten gelben Streifen als Zeichen der Schande auf sein
Hemd; später wird seine Familie beinahe zerbrechen, und als die wenigen Männer
getötet werden, die seinen Geheimauftrag kannten, muß er Momente einer geradezu
quälenden Verlassenheit erleben. SPRINGFIELD RIFLE ist übrigens auch ein
visuell sehr schöner Film, mit wunderbaren Schneeszenen (die de Toth unter
Protest seines Kameramanns drehte); und ein sehr intelligenter Film, in dem es
um das Verhältnis von ehrbarem Handeln und dem Urteil der Menschen geht, oder,
einmal kantianisch formuliert, um die Bedingungen der Möglichkeit von
Rechtschaffenheit an sich.
Sechs Filme hat de Toth zwischen
1951 und 1954 mit dem Westernstar Randolph Scott gedreht, und auch wenn ihre Qualität
nicht an die besten Filme des berühmten Ranown-Zyklus heranreicht, den Scott in
der zweiten Hälfte der 50er unter der Regie von Budd Boetticher gedreht hat, so
gibt es doch keinen schwachen oder auch nur mittelmäßigen Film unter ihnen, und
drei oder vier sehr gute. In THE STRANGER WORE A GUN (DER SCHWEIGSAME FREMDE)
mag ich besonders den Anfang, eine sehr düstere Episode, die den Überfall des
berühmten Banditenobersten Quantrill auf eine Kleinstadt in Kansas während des
Bürgerkriegs zeigt, und direkt danach eine wunderschöne Sequenz auf einem
Raddampfer. Später gibt es dann noch eine hinreißende Szene, in der Scott von
den Kreolinnen in New Orleans erzählt, und die Augen des Rauhbeins Ernest
Borgnine beginnen zu leuchten, wenn er sich das ausmalt ... Und es gibt eine
schöne Liebesgeschichte zwischen Scott und Claire Trevor. – THE BOUNTY HUNTER
(DER RITTER DER PRÄRIE) ist fast eher ein Krimi als ein Western; Scott ist ein
Kopfgeldjäger, der von der Pinkerton-Agentur angeheuert wird, um drei Postkutschenräuber
zu finden, und das wird dann zu einem Whodunit in einer kleinen Stadt im Wilden
Westen. Der Film hat ein etwas fahriges Drehbuch, aber allein eine Nebenfigur
wie der Arzt der Stadt, der an der Flasche hing und überall Schiffbruch
erlitten hat und sich jetzt, müde geworden vom Leben, hier niedergelassen hat
und prompt unschuldig zum Mitwisser des Überfalls wird – mit all jener Wärme
gezeichnet, die de Toth für die am Leben Gescheiterten aufgebracht hat –, lohnt
das Ansehen. – Auch der Kavalleriefilm THUNDER OVER THE PLAINS (DONNERNDE HUFE)
hat Krimielemente (es geht um die Suche nach einem Mörder). Es ist ein visuell
besonders schöner Film: de Toth bringt eine europäische Sensibilität in den
Film ein, eine Lust an der virtuosen Inszenierung mancher Sequenzen, ein
Chiaroscuro der Lichtsetzung – insbesondere die Verfolgungsszenen sind
grandios: wie der Denunziant durch die nächtlichen Straßen gehetzt wird, oder
wie Randolph Scott und der Anführer der Rebellen sich in einem Wäldchen
verfolgen, oder der Showdown am Ende, wieder mit diesem reichen
Licht-Schatten-Spiel. Eine sehr schöne Rolle hat der junge Lex Barker: der
spätere Old Shatterhand als extrem schmieriger junger Karriereoffizier, der
auch noch hinter Scotts Frau her ist. – In RIDING SHOTGUN (DIESER MANN WEISS
ZUVIEL) wird Scott irrtümlich für ein Mitglied einer berüchtigten Gangsterbande
gehalten und muß sich auf einmal gegen eine ganze Stadt verteidigen, deren
Einwohner ihn noch kurz zuvor für einen ehrbaren Mann hielten; mehr als nur ein
Hauch von McCarthy spukt durch diesen Film, der im Geiste von Klassikern wie
Allan Dwans SILVER LODE oder Nicholas Rays JOHNNY GUITAR gedreht wurde. Daß die
Manipulierbarkeit der Massen ein bedeutendes Thema in de Toths Western ist,
wird einem von diesem Film aus betrachtet erst richtig klar: immer wieder gibt
es auch in seinen anderen Filmen Szenen, in denen eine Menge plötzlich vom
Blutdurst gepackt und irgendeiner als Sündenbock ausgeguckt wird, und dann ist
der Lynchstrick schon nicht mehr weit ... Außerdem gibt es ein Rachemotiv in
RIDING SHOTGUN – Scott ist schon seit Jahren hinter dem wahren Anführer der
Bande her, weil er einst seine Schwester und deren kleinen Sohn getötet hatte
–, das eines der zentralen Themen des Boetticher-Scott-Zyklus vorwegnimmt. Für
Bertrand Tavernier ist RIDING SHOTGUN der beste Randolph-Scott-Western von de
Toth. – MAN IN THE SADDLE (MANN IM SATTEL) ist ein ganz exzellenter Film. Am
Anfang verliert Scott die Frau, die er liebt, an den größten Rancher der Gegend
(Alexander Knox); sie hat sich für finanzielle Sicherheit und ein behagliches
Leben an der Seite eines wohlhabenden Mannes entschieden, für die Vernunft und
gegen ihr Herz. Leider wird Knox aber von Eifersucht zerfressen; er möchte
alles ganz und gar besitzen, das Land ebenso wie seine Frau, die immer noch an
Scott hängt. Daher zettelt er einen Kleinkrieg mit Scott an und hat sich dabei
natürlich den falschen Gegner ausgesucht. Es gibt tolle Ideen in diesem Film,
etwa eine Schießerei in einem völlig finsteren Saloon, der nur vom
Mündungsfeuer der Revolver illuminiert wird; es gibt eine herrliche
Dialogzeile, wenn Scott sich entschließt, den Kampf bis aufs Messer aufzunehmen
und vor seinem ersten Schuß sagt: „Immer auf der Veranda sitzen 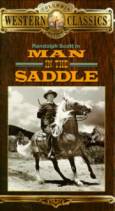 ist
auch langweilig“ (überhaupt gibt es viel lakonischen Humor in diesen Filmen);
und eine schöne, sich langsam entwickelnde Liebesgeschichte zwischen Scott und
einer Nachbarin, die sich als viel netter herausstellt als Scotts große Liebe,
die am Ende dem Besitz den Vorzug gibt. Und es gibt eine schöne traurige
Außenseiterrolle für John Russell, der einen Mann aus den Bergen spielt, der
immer wieder in die Stadt kommt, aber nie sieht ihn dort eine Frau an; das
macht ihn dann so rasend, daß er Scott und die Nachbarin erschießen will
(woraus ein irrwitziger Faustkampf an einem Abhang in den Bergen wird); am Ende
stirbt er einen gemeinen und schmutzigen Tod, er wird aufgrund eines
Mißverständnisses von Knox geradezu sadistisch hingerichtet. – Das Meisterwerk
dieser Reihe ist für mich aber CARSON CITY (SABOTAGE) von 1952, in dem es um
den Eisenbahnbau im Westen geht. Die erste halbe Stunde ist herausragend: der
vielleicht schrägste Postkutschenüberfall der Westerngeschichte (die Passagiere
werden da mit einem Picknick verwöhnt: während die Goldkiste aufgebrochen wird,
kredenzt man ihnen Hühnchen und Champagner), die Einführung von Randolph Scott
– hier in der Rolle eines abenteuerlustigen Eisenbahningenieurs – mit einer
furiosen und sehr witzigen Kneipenschlägerei, dann die Ankunft Scotts in Carson
City, das zunächst wie das liebenswerteste und heimeligste Westernstädtchen
erscheint, das man sich nur denken kann. Später gibt es dann eine spannende
Szene mit einem eingestürzten Tunnel, in dem Scott und einige seiner Arbeiter
verschüttet sind. Und kurz vor Schluß eine kurze Szene – oder eigentlich nur
eine einzige Einstellung –, die ebenbürtig neben den besten Momenten der
Boetticher-Filme stehen kann: Raymond Massey, der Schurke des Films, hat Scotts
Stiefbruder getötet, der sich mit Scott überworfen hatte und mit den Worten
stirbt, es sei manchmal schwer, um Verzeihung zu bitten; Scott kniet neben
seinem toten Bruder, streicht ihm durchs Haar, eine Geste, in der ein
unendliches Leid zu liegen scheint und eine maßlose Enttäuschung über all die
verpaßten Chancen und die verrückten Irrwege, die man im Leben geht und
vielleicht gehen muß, er hält einen Moment inne und greift dann (wie in der
Fortsetzung der Bewegung, mit der er seinem toten Bruder durchs Haar strich) zu
seinem Revolver, um Rache zu nehmen: wie in dieser ganz kurzen Szene Scotts
reichhaltige Empfindungen und Gedanken ganz und gar zur puren Geste werden, zur
Dynamik einer Bewegung, ist einfach ein kleines Wunder an Präzision und
emotionaler Tiefe.
ist
auch langweilig“ (überhaupt gibt es viel lakonischen Humor in diesen Filmen);
und eine schöne, sich langsam entwickelnde Liebesgeschichte zwischen Scott und
einer Nachbarin, die sich als viel netter herausstellt als Scotts große Liebe,
die am Ende dem Besitz den Vorzug gibt. Und es gibt eine schöne traurige
Außenseiterrolle für John Russell, der einen Mann aus den Bergen spielt, der
immer wieder in die Stadt kommt, aber nie sieht ihn dort eine Frau an; das
macht ihn dann so rasend, daß er Scott und die Nachbarin erschießen will
(woraus ein irrwitziger Faustkampf an einem Abhang in den Bergen wird); am Ende
stirbt er einen gemeinen und schmutzigen Tod, er wird aufgrund eines
Mißverständnisses von Knox geradezu sadistisch hingerichtet. – Das Meisterwerk
dieser Reihe ist für mich aber CARSON CITY (SABOTAGE) von 1952, in dem es um
den Eisenbahnbau im Westen geht. Die erste halbe Stunde ist herausragend: der
vielleicht schrägste Postkutschenüberfall der Westerngeschichte (die Passagiere
werden da mit einem Picknick verwöhnt: während die Goldkiste aufgebrochen wird,
kredenzt man ihnen Hühnchen und Champagner), die Einführung von Randolph Scott
– hier in der Rolle eines abenteuerlustigen Eisenbahningenieurs – mit einer
furiosen und sehr witzigen Kneipenschlägerei, dann die Ankunft Scotts in Carson
City, das zunächst wie das liebenswerteste und heimeligste Westernstädtchen
erscheint, das man sich nur denken kann. Später gibt es dann eine spannende
Szene mit einem eingestürzten Tunnel, in dem Scott und einige seiner Arbeiter
verschüttet sind. Und kurz vor Schluß eine kurze Szene – oder eigentlich nur
eine einzige Einstellung –, die ebenbürtig neben den besten Momenten der
Boetticher-Filme stehen kann: Raymond Massey, der Schurke des Films, hat Scotts
Stiefbruder getötet, der sich mit Scott überworfen hatte und mit den Worten
stirbt, es sei manchmal schwer, um Verzeihung zu bitten; Scott kniet neben
seinem toten Bruder, streicht ihm durchs Haar, eine Geste, in der ein
unendliches Leid zu liegen scheint und eine maßlose Enttäuschung über all die
verpaßten Chancen und die verrückten Irrwege, die man im Leben geht und
vielleicht gehen muß, er hält einen Moment inne und greift dann (wie in der
Fortsetzung der Bewegung, mit der er seinem toten Bruder durchs Haar strich) zu
seinem Revolver, um Rache zu nehmen: wie in dieser ganz kurzen Szene Scotts
reichhaltige Empfindungen und Gedanken ganz und gar zur puren Geste werden, zur
Dynamik einer Bewegung, ist einfach ein kleines Wunder an Präzision und
emotionaler Tiefe.
Man könnte noch eine Menge zu den schönen kleinen de-Toth-Western aus der ersten Hälfte der 50er Jahre sagen; aber sie verblassen gegenüber seinen beiden letzten Werken in diesem Genre: INDIAN FIGHTER von 1955, mit Kirk Douglas und Elsa Martinelli, und DAY OF THE OUTLAW von 1959, mit Robert Ryan und Burt Ives; einer der größten lyrischen Erfolge der Westerngeschichte, und eines seiner tiefsten moralischen Meisterwerke.
IV
Ein Siedlertreck zieht nach Westen, nach Oregon, durch das Land der Sioux; begleitet wird er von einem Fotografen (Elisha Cook), der einmal Halt macht, um ein idyllisches Tal inmitten grandioser Berge abzulichten. Der Fotograf erzählt dem Anführer des Trecks, Johnny Hawks (Kirk Douglas), von seinem Traum, den ganzen Wilden Westen zu fotografieren, um ihn bekannt zu machen; dann werden eines Tages Tausende von Menschen in den Westen kommen und ihm die Zivilisation bringen. Johnny Hawks meint, das sei eigentlich nur ein Grund, seine Kamera zu zerstören: „Der Westen“, sagt er, „kommt mir vor wie eine Frau, meine Frau. Ich liebe sie, wie sie ist, und will sie nicht anders haben. Ich bin eifersüchtig und will sie vor fremden Blicken verbergen. Nein, sie soll nicht zivilisiert werden.“ „Erlaubst du also nicht, daß ich die Fotos mache“, fragt der Fotograf, und Hawks grinst (wie eben nur Kirk Douglas grinsen kann) und sagt: „Nein, wenn du’s nicht tust, kommen andere.“ Dann nimmt er ihn mit auf sein Pferd und reitet zurück zum Treck.
Ein großes Thema und eine
Geschichte, aus der man einen ganzen Western machen könnte (und oft genug ja
auch gemacht hat); in INDIAN FIGHTER ist es aber nur eine fast beiläufig
abgehandelte kleine Episode am Rande, was schon sehr viel sagt über die
entspannte Lässigkeit dieses wunderbaren Films, der große Dinge scheinbar ganz
leicht behandelt und dabei am Ende einen viel tieferen Eindruck in unseren
Herzen hinterläßt als so mancher hochgerühmte Thesenwestern. Und dabei muß man
natürlich eigentlich noch den Blick sehen, mit dem der tapfere kleine Mann
Elisha Cook, der so gar nicht in diese wilde Natur zu passen scheint, von
seinem Traum erzählt, und den Blick von Kirk Douglas, wenn er von seiner Liebe
zur ungezähmten Wildnis spricht, und man spürt die ganze Wärme, mit der André
de Toth beiden Männern zugetan ist: weil sie beide auf ihre Weise von etwas
Schönem träumen, und weil sie mit ganzem Herzen ihren Traum verfolgen und weil
sie doch  auch
beide den anderen und seine Idee verstehen können. Und über dem letzten Satz
von Johnny Hawks liegt natürlich trotz seines Lächelns eine große Melancholie:
weil er weiß, daß seine Welt zu Ende gehen wird und muß, eines Tages.
auch
beide den anderen und seine Idee verstehen können. Und über dem letzten Satz
von Johnny Hawks liegt natürlich trotz seines Lächelns eine große Melancholie:
weil er weiß, daß seine Welt zu Ende gehen wird und muß, eines Tages.
Das ist eine der schönsten Szenen aus einem der schönsten Western überhaupt. Obwohl INDIAN FIGHTER viel Action bietet – darunter einen fantastischen Zweikampf zwischen Johnny Hawks und einem Sioux, den de Toth wie ein mittelalterliches Turnier inszeniert, mit zwei Schimmeln und Lanzenstechen –, bezaubert er mich doch vor allem immer wieder mit seiner Gelassenheit, seinem entspannten Rhythmus, seinen ruhigen, langen Einstellungen, die aus sich selber heraus zu atmen und zu leben beginnen. Und es ist vielleicht der allerschönste Film über die Natur des amerikanischen Westens, die in Totalen und Panoramaschwenks gezeigt und geradezu zum Protagonisten der Handlung wird: die Nadelwälder und lichten grünen Auen, die Täler und schroffen Bergketten und der Fluß, der zum Schauplatz einer der tollsten und erotischsten Liebesszenen der Filmgeschichte wird, zwischen Kirk Douglas und Elsa Martinelli, die hier als Indianerin Onathi ihr Kinodebüt gegeben hat – „La rivière de nos amours“ hieß der Film in Frankreich, „Der Fluß unserer Lieben“, einer der raren Fälle, in denen ein Synchrontitel noch schöner ist als das Original (in Deutschland lief er unter zwei Titeln: ZWISCHEN ZWEI FEUERN, was plausibel, aber nicht sehr poetisch ist, und ALS VERGELTUNG SIEBEN KUGELN, was schlicht doof ist).
Um einen Siedlertreck geht es also, wie gesagt, und um seinen Führer Johnny Hawks, der die Indianer und die Weißen gleichermaßen mag; der Sioux-Häuptling Rote Wolke ist ein alter Freund von ihm, und andererseits fühlt er sich auch den Siedlern und den Kavalleristen im neu errichteten Fort verbunden. Und genauso steht er dann auch zwischen zwei Frauen, der wilden Indianerin Onathi, mit der er heiße Liebesspiele in den Wäldern und im Fluß treibt (woran Douglas und Martinelli offensichtlich viel Spaß hatten), und der verwitweten Siedlerin Susan Rogers, die ihn mit nach Oregon nehmen will, nicht zuletzt auch, um ihrem kleinen Sohn, der Hawks bewundert, einen neuen Vater zu geben. (Johnny hat da allerdings einen Rivalen unter den Siedlern, dem de Toth einen wunderbaren Moment gönnt, wenn er einmal abends zu Susan kommt und ihr unbedingt etwas sagen will – man erwartet natürlich eine Liebeserklärung, und dann sagt er: „Ich bin der beste Kartoffelzüchter von Michigan“, und irgendwie ist es natürlich dann auch eine Art Liebeserklärung, ungemein rührend in ihrer ganzen Unbeholfenheit.) Eigentlich sollte alles glatt gehen mit dem Treck, die Sioux haben gerade einen Friedensvertrag geschlossen; aber leider gibt es Gold im Land der Indianer, und zwei schmierige Halunken im Treck (Walter Matthau, der auf eher ungewohntem Territorium eine ziemlich gute Figur macht, und Lon Chaney jr.), die unbedingt den geheimen Fundort des Goldes entdecken wollen und nicht davor zurückschrecken, einen neuen Indianerkrieg zu entfesseln, wenn es ihren Zwecken dient. So kommt es dann auch: die Indianer belagern das Fort und erweisen sich dabei als überlegene Strategen; fast möchte man INDIAN FIGHTER wegen dieser überlegen inszenierten Attacken auch als einen der besten aller Kriegsfilme bezeichnen. Aber eigentlich sind diese tollen Actionszenen dann doch ein wenig zweitrangig gegenüber den anderen Schönheiten des Films. Und der wahre Showdown am Schluß wird, passend zu diesem humanen und schönen Western, allein mit Worten ausgetragen. „Ich gebe die ganzen Fords und die ganzen Walshs der Zeit von 1940 bis 1955 für diesen einen INDIAN FIGHTER, eines der schönsten pantheistischen Poeme, die der Western uns geschenkt hat“, schrieb der französische Kritiker Patrick Bureau; das ist freilich etwas übertrieben; aber INDIAN FIGHTER nimmt einen ehrenvollen Platz auch neben den allerbesten Filmen von Ford und Walsh ein.
V
Ein Schnee-Western in Schwarz-Weiß: einmal gibt es einen hinreißenden Panoramaschwenk in DAY OF THE OUTLAW (TAG DER GESETZLOSEN), über die verschneite Einöde von Wyoming, die von den schwarzen Silhouetten der Berggipfel und der Tannenwälder akzentuiert wird, und dann auf das kleine Dorf, das Schauplatz der Handlung ist, das wirkt zuerst wie eine chinesische Tuschzeichnung, die langsam entrollt wird, und am Ende wie eine uralte Fotografie. – Der Schnee und die bittere Kälte erscheinen einem fast wie die eigentlichen Protagonisten dieses Films, und das Eis, das sich über den erfrorenen Herzen der Menschen kristallisiert hat.
Robert Ryan spielt den alternden Viehzüchter Blaise Starrett, der vor vielen Jahren mühsam seine Existenz in der unwirtlichen Landschaft aufgebaut, so etwas wie eine rudimentäre Ordnung geschaffen hat und sich als Herr seines kleinen Fleckens Erde fühlt; nun aber drängen Farmer aus dem Osten nach und wollen seine Ordnung zerstören. Mit Stacheldraht beginnt der Film; einer der Farmer hat ihn sich schicken lassen, und Starrett muß natürlich etwas gegen ihn unternehmen; eine der klassischen Westerngeschichten scheint sich anzubahnen, in der Tradition von Filmen wie King Vidors MAN WITHOUT A STAR. Dahinter steckt aber auch noch eine private Fehde: der Farmer hat die Frau geheiratet, die Starrett liebt. Nach einer ersten verbalen Auseinandersetzung mit den Farmern geht Starrett auf sein Zimmer im Saloon, und allein wie er sich da auf seinen Stuhl setzt, sagt alles über ihn: Er ist einsam, verbittert und des Kampfes müde, sterbensmüde. Diese kurze Einstellung allein würde schon alle Ehre einlegen für Robert Ryan, einen der ganz großen Schauspieler des klassischen Hollywood, und für seinen Regisseur. Aber dann rafft er sich doch noch einmal auf für den Showdown: Er muß seinen Weg gehen, auch wenn er im tiefsten Inneren schon längst weiß, daß es der falsche Weg ist.
Dazu kommt es allerdings nicht,
denn als Starrett und sein Kontrahent sich gegenüberstehen, die Hand schon
schußbereit am Revolver, bricht eine Verbrecherbande auf der Flucht vor der
Kavallerie im Dorf ein, und der Tag der Gesetzlosen beginnt. Angeführt wird die
Bande von Captain Bruhn – Burt Ives, hier (wie de Toth es gerne zu tun pflegte)
ganz gegen seinen üblichen jovialen Typ besetzt –, einem ehemaligen Kavallerieoffizier;
im Hintergrund gibt es noch eine alte Geschichte, die Starrett  einmal
gehört hat; wir werden diese Geschichte nie erfahren, aber sie muß etwas mit
wahrem Heldenmut und Offiziersehre zu tun haben. Bruhn hat seinen wüsten Haufen
zwar fest im Griff und ihm Alkohol und Übergriffe auf die Dorfbewohner und
insbesondere die Frauen untersagt (einmal wird er allerdings ein bizarres
Tänzchen erlauben, um die Spannungen abzubauen, eine der berühmtesten
de-Toth-Szenen, mit ihrer hinter der wilden Ausgelassenheit fühlbaren
Sexualität und Gewalt, gefilmt mit einer sinnlos-irr in 360°-Schwenks um sich
kreisenden Kamera; eine ganz ähnlich inszenierte und doch von der Stimmung her
ganz andere Tanzszene gibt es auch in INDIAN FIGHTER). Aber Bruhn hat eine Kugel
im Leib, und obwohl der Tierarzt des Ortes sie erfolgreich entfernen kann, wird
er über kurz oder lang an seinen inneren Blutungen zugrundegehen. Starrett
bietet der Bande daher an, sie auf einem geheimen Weg aus dem Tal
hinauszubringen. Aber es gibt gar keinen geheimen Weg, und Starrett will sie
nur in ihren Tod führen. Der Plan fliegt auf, weil sich eines der Mädchen aus
dem Dorf (die schon immer von einem Fremden geträumt hat, der in ihr einsames
Leben kommt) in Bruhns jüngsten Komplizen verliebt hat. Von Bruhn zur Rede
gestellt, sagt Starrett ihm schonungslos, daß er bald sterben werde und das
Dorf dann seinen Männern schutzlos ausgeliefert sei; es gebe für ihn nur noch
die Wahl, wie ein Schwein oder mit einer ehrbaren Tat zu sterben. Bruhn
beschließt, seinen Männern nichts zu sagen und aufzubrechen, in den Tod. Zwei
Männer, im Leben gescheitert und bitter geworden, die sich an ihre Ehrbarkeit
erinnern, daran, was sie einmal waren und was sie jetzt nur noch im Angesicht
des Todes noch einmal werden können: Es ist einer der ganz großen Momente des
Westerns als moralische Kunst, der wie kein anderes Genre lakonisch und
unsentimental erzählen kann vom richtigen Handeln und vom richtigen Sterben.
einmal
gehört hat; wir werden diese Geschichte nie erfahren, aber sie muß etwas mit
wahrem Heldenmut und Offiziersehre zu tun haben. Bruhn hat seinen wüsten Haufen
zwar fest im Griff und ihm Alkohol und Übergriffe auf die Dorfbewohner und
insbesondere die Frauen untersagt (einmal wird er allerdings ein bizarres
Tänzchen erlauben, um die Spannungen abzubauen, eine der berühmtesten
de-Toth-Szenen, mit ihrer hinter der wilden Ausgelassenheit fühlbaren
Sexualität und Gewalt, gefilmt mit einer sinnlos-irr in 360°-Schwenks um sich
kreisenden Kamera; eine ganz ähnlich inszenierte und doch von der Stimmung her
ganz andere Tanzszene gibt es auch in INDIAN FIGHTER). Aber Bruhn hat eine Kugel
im Leib, und obwohl der Tierarzt des Ortes sie erfolgreich entfernen kann, wird
er über kurz oder lang an seinen inneren Blutungen zugrundegehen. Starrett
bietet der Bande daher an, sie auf einem geheimen Weg aus dem Tal
hinauszubringen. Aber es gibt gar keinen geheimen Weg, und Starrett will sie
nur in ihren Tod führen. Der Plan fliegt auf, weil sich eines der Mädchen aus
dem Dorf (die schon immer von einem Fremden geträumt hat, der in ihr einsames
Leben kommt) in Bruhns jüngsten Komplizen verliebt hat. Von Bruhn zur Rede
gestellt, sagt Starrett ihm schonungslos, daß er bald sterben werde und das
Dorf dann seinen Männern schutzlos ausgeliefert sei; es gebe für ihn nur noch
die Wahl, wie ein Schwein oder mit einer ehrbaren Tat zu sterben. Bruhn
beschließt, seinen Männern nichts zu sagen und aufzubrechen, in den Tod. Zwei
Männer, im Leben gescheitert und bitter geworden, die sich an ihre Ehrbarkeit
erinnern, daran, was sie einmal waren und was sie jetzt nur noch im Angesicht
des Todes noch einmal werden können: Es ist einer der ganz großen Momente des
Westerns als moralische Kunst, der wie kein anderes Genre lakonisch und
unsentimental erzählen kann vom richtigen Handeln und vom richtigen Sterben.
Bruhn stirbt auf der Flucht, ein Lächeln der Erlösung liegt auf dem Gesicht des Toten. Unmittelbar danach verlieren seine Männer alle Hemmungen: 40.000 Dollar in Gold gibt es zu verteilen, geraubt von der Armee, und ein Siebtel davon ist eine schöne Summe, aber ein Fünftel ist besser, oder ein Viertel ... Am Ende bleiben zwei der Gangster und Starrett übrig, hoch im Gebirge, in eisiger Nacht, ohne ein Feuer; am nächsten Morgen ist einer der Outlaws tot und dem anderen sind die Hände erfroren. Starrett reitet davon, und der andere folgt ihm, das Gewehr in den Armen, aber er kann den Abzug nicht mehr bedienen. Es ist einer der irrsinnigsten und wahrhaft unvergeßlichen Showdowns der Westerngeschichte.
VI
In den 60er Jahren ging de Toth nach Italien, wie so viele amerikanische Regisseure, wo er drei Filme inszenierte. Danach arbeitete er unter anderem für David Lean an LAWRENCE OF ARABIA, produzierte Ken Russells schrägen Agentenfilm BILLION DOLLAR BRAIN und inszenierte als Second-Unit-Director die Flugszenen des ersten SUPERMAN-Films. Dazwischen noch eine eigene Regiearbeit, PLAY DIRTY (EIN DRECKIGER HAUFEN) von 1969, ein Kriegsfilm im Niemandsland hinter den Linien von Rommels und Montgomerys Nordafrikafeldzügen. PLAY DIRTY greift die Idee von Robert Aldrichs THE DIRTY DOZEN auf, den Krieg mit Sonderkommandos aus Schwerverbrechern zu führen, und denkt sie konsequent zu Ende: denn bei de Toth triumphieren die Kriminellen nicht, weil sie am Schluß doch ihren edlen und heldenhaften Kern entdecken, sondern gerade weil sie nichts als verkommen und amoralisch sind. „Krieg“, sagt der Althistoriker, der die Sonderkommandos leitet, „ist eine kriminelle Sache, deshalb führe ich ihn mit Verbrechern.“ Der Film ist dabei manchmal wirklich atemberaubend zynisch, vom ersten Massaker an einer Beduinengruppe bis zur lakonisch finsteren Schlußpointe. Und als größter Verbrecher von allen stellt sich der von Harry Andrews gespielte General heraus: als sich die Strategie der Briten ändert und es auf einmal nicht mehr darauf ankommt, Rommels zentrales Treibstofflager zu zerstören, sondern es für Montgomerys Vormarsch zu bewahren, und das Kommando nicht mehr zurückgeholt werden kann, sagt er zu dem Historiker: „Sie kennen doch bestimmt einen Doppelagenten.“ Ob er diese Aufforderung zum Verrat schriftlich haben könne, fragt dieser, und Andrews sagt: „Nein. Aber es wäre besser, sie führen den Befehl aus.“ Ein zynischer Film, neben dem ein Samuel Fuller fast schon sentimental erscheint, aber er ist nie kalt (wie tief de Toth hier auch sein Herz unter Dornen verbergen mag); unsympathische Helden, aber sie wachsen einem ans Herz – und vor allem ist PLAY DIRTY auf seine Art ungeheuer unterhaltsam. Gedreht wurde der Film im spanischen Almeria, damals ein beliebter Drehort; eines Tages tauchte aus dem Nichts ein Indianerstamm auf und machte Jagd auf die Panzer: die Statisten hatten sich im Set geirrt.
Besonders am Herzen lagen de Toth immer seine Bronzestatuetten. Seine eigenen Filme will er nach seiner Aussage nie gesehen haben; ihn habe immer nur interessiert, sich weiterzuentwickeln, aus seinen Fehlern zu lernen, neue künstlerische Experimente zu unternehmen. Alle seine Filme seien ohnedies schlecht. Aber wenn INDIAN FIGHTER und CRIME WAVE schlechte Filme sind, sollte es viel mehr von der Sorte geben. „Deep down“, sagte er, „maybe I’d like to be remembered as someone who wasn’t careful but had a lot of fun.“ Am 27. Oktober 2002 ist André de Toth gestorben – diesmal, wie es scheint, für immer.